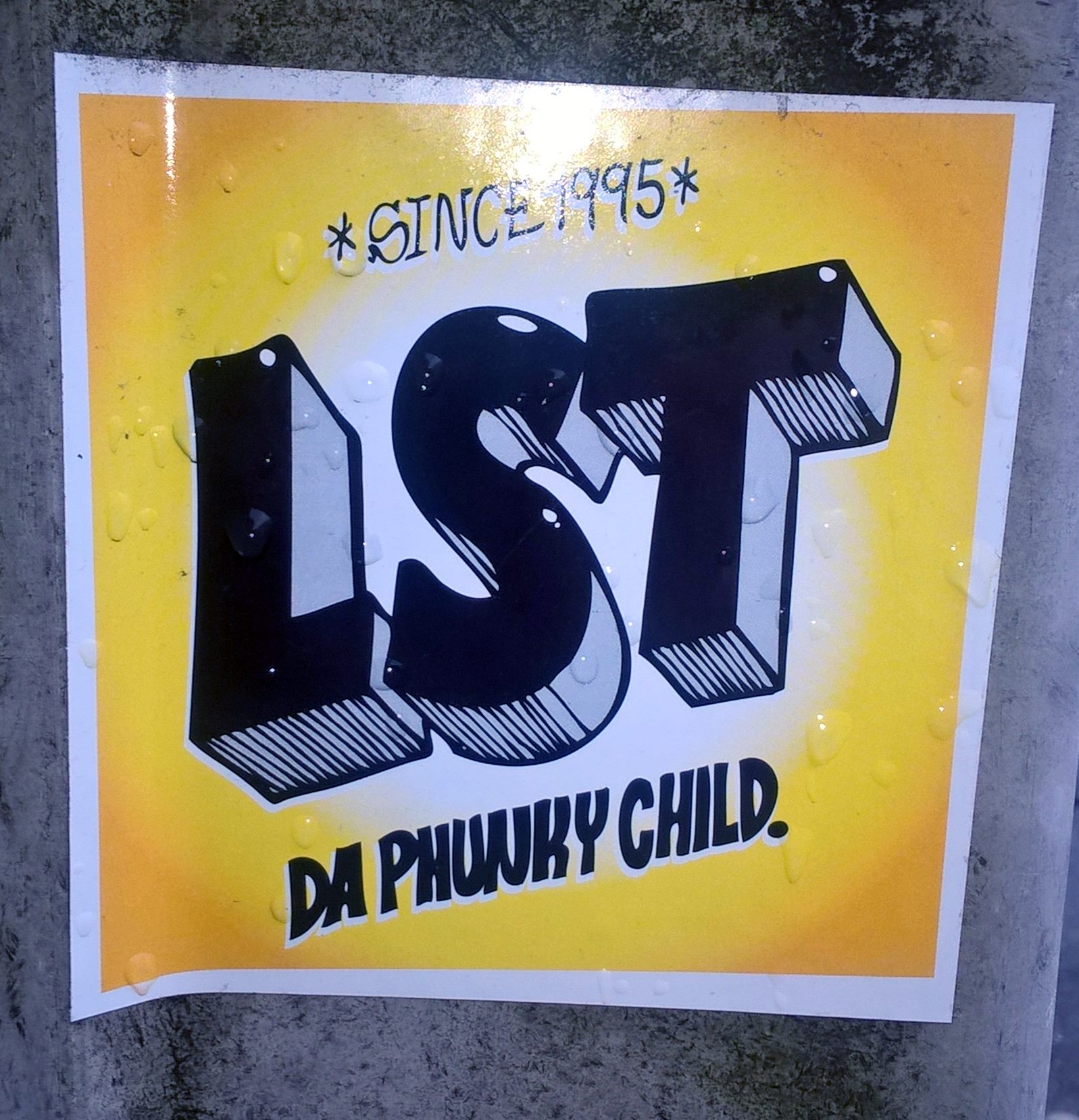Der 7. September 1864 bildet einen der größten Wendepunkte in meinem Leben. Aus den engen Klostermauern der Pforta trat ich in die weite Welt, auf die strenge Schulordnung und das auf ihr beruhende, geregelte, erfreuliche Fortschreiten folgte nun eine völlige Freiheit, in die ich mich längere Zeit nicht zu finden wußte. Meiner Mutter und ihren engen religiösen Ansichten war ich schon mehr entwachsen, als ich es ihr selbst gestehen mochte, mein Vater hat bei aller Liberalität, Jovialität und treuen Fürsorge doch niemals tiefer in unser geistiges Leben eingegriffen, und so fehlte es mir an jeder Leitung, während Nietzsche, der treue Kamerad, durch seine Gespräche und mehr noch durch sein Vorbild meine Natur nach allen Richtungen ins Unbegrenzte trieb, aber eben dadurch die Verfolgung eines festen Lebensplanes mehr verhinderte als beförderte. Nach einigen in seinem Elternhause zu Naumburg mit ihm verbrachten Wochen zogen wir beide nach dem Westen, zunächst nach Elberfeld, wo sich Ernst Schnabel als Dritter im Bunde anschloß, und dann nach einer übermütigen Reise über Königswinter und den Drachenfels gelangte das aus so verschiedenen Naturen zusammengefügte Dreigespann nach Oberdreis.
Am 15. Oktober feierten wir den Geburtstag meiner Mutter und zugleich den Nietzsches und stiegen dann von dem Gebirge des Westerwaldes in das Rheintal nach Neuwied hinab, von wo uns der Dampfer in wenigen Stunden nach Bonn führte.
Unsere erste Sorge war um eine Wohnung. Ursprünglich beabsichtigten wir, ein größeres Zimmer gemeinsam zu bewohnen, standen aber davon ab, als sich herausstellte, daß ein solcher Salon teurer als zwei einzelne Zimmer sein würde. Wir hatten aber beide Grund, unsere Mittel zu Rate zu halten. Mir konnten meine Eltern nur zwanzig Taler monatlich geben, während bei Nietzsche, der sein Erbteil von väterlicher Seite zum Studium verwendete, die Hoffnung bestand, daß er monatlich mit fünfundzwanzig Talern auskommen würde. In der Regelt war das wohl nicht möglich, und dann klagte er in Briefen an seine Mutter, daß das Geld immer so leicht weglaufe, wahrscheinlich weil es rund sei.
Wir mieteten also zwei einzelne »Buden«, wie der Studentenausdruck ist. Die meine lag in der Hospitalgasse, während die Nietzsches an ihrer Einmündung in die Bonngasse lag. Gegenüber ragte der Turm einer Kirche hervor, und Nietzsche besprach öfter mit mir den Plan, sich oben hoch bei dem Türmer einzumieten, um dem Lärm des Straßenlebens ferner zu sein. In Nietzsches Haus, beim Drechsler Oldag, hatten wir auch unsern Mittagstisch. Eine anmutige Verwandte des Hauses, Fräulein Mariechen, bediente uns und setzte sich öfter zu uns. Sie hatte ein rheinländisch freies, aber darum nicht ungesittetes Wesen, und es ist zu keiner nähern Beziehung zu ihr gekommen. In den nächsten Tagen ließen wir uns immatrikulieren, beide zunächst in der theologischen Fakultät. Aus ihr ging Nietzsche schon nach einem Semester, ich erst nach vier Semestern, zum Verdruß meiner Eltern, in die philosophische Fakultät über. Doch dies hing mit äußeren Verhältnissen zusammen. Unser eigentliches Studium war von vornherein klassische Philologie; Ritschl und Jahn waren die Koryphäen, die uns nach Bonn gezogen hatten. An beide, wie auch an Schaarschmidt, hatten wir von Pforta gemeinsame Empfehlungen. Wir erschienen bei Jahn. Er las den Brief und sagte treuherzig aber kurz: »Wenn ich Ihnen irgend nützlich sein kann, so wenden Sie sich nur an mich.« Wir kamen zu Ritschl, in dessen Haus ein fortwährendes Kommen und Gehen und kurzes Abfertigen der Studenten stattfand. Er riß den Brief eilfertig auf: »Ach, mein alter Freund Niese! Was macht der denn? Geht es ihm gut? Also Deussen ist Ihr Name. Nun, besuchen Sie mich recht bald wieder.« Nietzsche stand betroffen und konnte sich nicht enthalten zu bemerken, daß auch von ihm in dem Briefe die Rede sei. »Ach jawohl,« rief Ritschl, »es sind ja zwei Namen, Deussen und Nietzsche. Freut mich, freut mich. Nun, meine Herren, besuchen Sie mich recht bald wieder.« Diese Aufnahme unserer Empfehlungsbriefe war nicht sehr ermutigend, und da Schaarschmidt nicht zu Hause war, so ließen wir unsern Empfehlungsbrief bei ihm und dachten nicht weiter an die Sache. Aber Schaarschmidt ließ uns besonders zu sich entbieten. Wir fanden in ihm einen bis zur Unruhe lebhaften, beweglichen Mann und sahen uns, als wir von ihm kamen, erstaunt an. Das also ist ein Philosoph? Einen solchen hatten wir uns allerdings ganz anders gedacht. Übrigens war Schaarschmidt der einzige, der sich unser wirklich annahm. Er zog uns in seine Familie, richtete für uns ein Plato-Kränzchen ein und hatte für alle Anliegen stets ein williges Ohr. Wir hörten bei ihm Geschichte der Philosophie und über die platonische Frage, dazu bei Ritschl Miles gloriosus und bei Jahn Symposion, daneben einige Theologika, die wir jedoch als allzu langweilig bald vernachlässigten. Um diese Zeit war das neue Leben Jesu von Strauß erschienen. Nietzsche schaffte es sich an, und ich folgte seinem Beispiele. In unsern Gesprächen konnte ich nicht umhin, meine Zustimmung auszudrücken. Nietzsche erwiderte: »Die Sache hat eine ernste Konsequenz; wenn du Christus aufgibst, wirst du auch Gott aufgeben müssen.«
Überwiegend fühlte sich Nietzsche in diesem ersten Studienjahr von den griechischen Lyrikern angezogen. Während ich sehr viel Zeit mit dem Sanskrit vertat, wählte er immer kleine Gegenstände, zeigte sich aber in diesen sogleich produktiv. Ein Lieblingsthema war das Danaelied des Simonides, dessen kritische Behandlung ihn lange beschäftigte. Daneben arbeitete er seinen Theognis für eine Seminararbeit um, interessierte sich schon für Homer, Sokrates, Diogenes Laertius, und während es mein Bestreben damals war, die Dichter und Denker zu genießen und in ihrem Genusse auszuruhen, fand er keine Befriedigung, wo er nicht produktiv sein konnte. Inzwischen waren für uns beide Verhältnisse eingetreten, welche die wissenschaftliche Arbeit fürs erste sehr einschränken sollten. Wir hatten beide keine besondere Neigung gehabt, einer Verbindung beizutreten, aber ansehen wollten wir uns die Sache, und so hatten wir nichts dagegen einzuwenden, als Stöckert, ein ehemaliger Pförtner und jetziger Francone, uns einlud, ihn auf die Franconenkneipe zu begleiten. Hier hatten sich als Gäste außer uns beiden noch fünf weitere Pförtner eingefunden; die Stimmung war sehr animiert, und als einer der Pförtner, ich glaube es war der jetzt in Rudolstadt wirkende Haushalter, unter dem frenetischen Jubel der zirka dreißig Franconen seinen Eintritt erklärte, da folgten bald der zweite und dritte und zuletzt alle sieben Pförtner, mit Einschluß von Nietzsche und mir. Wir gingen nach Hause mit dem dämmernden Bewußtsein, daß wir uns gegen unsere Vorsätze hatten fortreißen lassen und einen Schritt getan hatten, dessen Folgen sich noch nicht übersehen ließen. In der Franconia, der an einem Abende so viele wertvolle Elemente zugefallen waren, herrschte damals ein reges burschikoses Leben, welches bei jeder Gelegenheit in Exzentrizitäten ausartete. Besonderes Wohlgefallen konnte weder Nietzsche noch ich daran finden. Die patriotischen Simpeleien hatten für uns als Kosmopoliten wenig Reiz, das zwangsweise betriebene wüste Trinken an den Kneipabenden widerte uns an. Der pedantische Unterricht, den uns in Kapiteln und Paragraphen der Fuchsmajor über die trivialsten Dinge erteilte, erschien uns lächerlich, und wenn wir fast alle Sonnabende die Vorlesungen, mochten sie auch noch so interessant sein, schwänzen mußten, um in einer abgelegenen Scheune außerhalb der Stadt zuzusehen, wie Franconen und Alemannen sich die Gesichter zerhackten, so konnten wir auch daran kein Wohlgefallen finden. Natürlich wurde der Paukboden eifrig besucht; auch Nietzsche übte sich so gut er konnte, und es gelang ihm denn auch, eine Forderung zum Duell zu erhalten. Die Art, wie er sich dabei benahm, war originell genug. »Ich ging gestern«, so erzählte er mir am folgenden Tage, »nach dem Kneipabend auf dem Markte spazieren. Ein Alemanne gesellte sich zu mir; wir hatten ein sehr animiertes Gespräch über allerlei Gegenstände der Kunst und Literatur, und beim Abschied bat ich ihn dann aufs höflichste, doch mit mir ›hängen‹ zu wollen. Er sagte zu, und nächstens werden wir miteinander losgehen.« Mit etwas bänglichen Gefühlen sah ich den Tag herannahen, an welchem unser Freund, der nicht nur wie Hamlet durch einen Lesefehler (fat für hot), sondern in Wirklichkeit etwas korpulent und dabei sehr kurzsichtig war, ein seinen Anlagen so wenig angemessenes Abenteuer bestehen sollte. Die Klingen wurden gebunden, und die scharfen Rapiere blitzten um die entblößten Köpfe. Es dauerte auch kaum drei Minuten, und es gelang dem Gegner, Nietzschen eine Tiefquart quer über den Nasenrücken zu applizieren, gerade an der Stelle, wo ein zu stark drückender Kneifer einen roten Eindruck zu hinterlassen pflegt. Das Blut tropfte zur Erde und wurde von den Sachverständigen für eine hinreichende Sühne alles Vergangenen befunden. Ich packte meinen wohlverbundenen Freund in einen Wagen, legte ihn zu Hause ins Bett, kühlte fleißig, verweigerte Besuche und Alkohol, und in zwei bis drei Tagen war unser Held wieder hergestellt bis auf eine kleine Narbe quer über dem Nasenrücken, die er zeitlebens behalten hat, und die ihm nicht übel stand. So ließen wir uns eine Zeitlang das mehr exzentrische als geistreiche Treiben unserer Verbindungsbrüder gefallen. Charakteristisch, mehr für das, was wir galten, als für das, was wir waren, sind die auf uns gemünzten Verse des Nationalliedes der Franconia, welches bei jeder Gelegenheit abgesungen wurde. Nietzsche hieß mit seinem Kneipnamen »Gluck«, mich pflegten sie »Meister« zu nennen. Unsere Verse lauteten:
Tragödien und Romanzen, dran er sich sehr ergötzt,
Hat Gluck viel komponieret und in Musik gesetzt.
Kommt abends er nach Hause, küßt ihn ein roter Mund;
Vor lauter Tee und Zuckerwerk kommt er noch auf den Hund.
Und mit heirassassa die Franconen sind da,
Die Franconen sind lustig, sie rufen hurra!
Ponssierend seine Nase sitzt Meister still zu Haus,
Ochst siebenundsiebzig Sprachen, raucht siebzehn Pfeifen aus.
Wenn er sich mal bekneipt hat, und man redet ihn an,
Antwortet er auf griechisch, der grundgelehrte Mann.
Und mit heirassassa die Franconen sind da,
Die Franconen sind lustig, sie rufen hurra!
Die Bemerkung über Tee und Zuckerwerk war nicht unrichtig. Nietzsche liebte die Süßigkeiten sehr und ließ sich oft dergleichen geben, während ich meine Zigarre rauchte. Scherzweise pflegten wir darüber zu streiten, welcher von uns bei seiner Weise billiger fortkomme. Was aber das erwähnte Küssen des roten Mundes betrifft, so habe ich nie bemerkt, daß Nietzsche zu dergleichen neigte.
Unsere Verbindung mit der Franconia war nicht von Dauer. Ich selbst trat auf dringlichen Wunsch meiner Eltern aus und wurde als beliebter Gesellschafter zum Konkneipanten ernannt, eine Vergünstigung, von der ich sehr wenig Gebrauch gemacht habe. Nietzsche verließ Bonn im August 1865, und zeigte dies der Verbindung erst von Leipzig aus in einem allzu aufrichtigen Briefe an. Er wurde infolgedessen dimittiert und ertrug dieses Schicksal mit der größten Gelassenheit.
Ich hörte in den ersten Semestern theologische Ethik bei J.P. Lange, ein Kolleg, aus dem ich jetzt wohl ebensowenig klug werden dürfte, wie ich es damals wurde. Gediegen, aber leblos und zum Sterben langweilig war die Kirchengeschichte bei Krafft, mehr Anziehung übte die Genesis bei Schlodtmann, bis mir auch dieses Kolleg durch die fortwährenden Versuche, die alten schönen Mythen und Sagen mit den Hirngespinsten der modernen Theologie zu vermitteln, zuwider wurde. Und als ich vollends dem Beispiele Nietzsches folgte und mir das eben erschienene neue Leben Jesu von Strauß anschaffte, da beschränkte sich meine Theologie fortan auf das Studium der Bibel in den Grundsprachen, und im übrigen hielt ich mich an philosophische Kollegia.
Als Koryphäen wirkten damals Ritschl und Jahn noch nebeneinander, bis im nächsten Sommer der Streit zwischen ihnen ausbrach, der die Übersiedlung Ritschls nach Leipzig zur Folge hatte. Viele Studenten folgten ihm, darunter auch Nietzsche. Ich selbst nahm mir vor, nach einem Semester nachzufolgen. Während der drei Semester meines ersten Bonner Aufenthaltes hörte ich bei Ritschl Plautus, Miles gloriosus, und Einleitung in die lateinische Grammatik, bei Jahn Platons Symposion und Einleitung in die Archäologie, später noch die Elektra des Sophokles. Ich kann nicht sagen, daß diese Kollegia mich sonderlich gefördert oder auch nur angeregt hätten. Ich hoffte, an der Hand dieser Männer in den großen, freien Geist des klassischen Altertums tiefer eingeführt zu werden und empfing statt dessen bei Ritschl Konjekturen und Varianten, bei Jahn Büchertitel und Zitate ohne Zahl. Diese Eindrücke haben wesentlich dazu mitgewirkt, mein Herz nicht dem klassischen Altertum, wohl aber der klassischen Philologie zu entfremden. Nun versuchte ich es mit der Philosophie. Mit Schweglers Geschichte der Philosophie kam ich nicht über den ersten Anlauf hinaus, und auch Schaarschmidts Vorlesungen vermochten nicht, eine dauernde Anziehungskraft zu üben. Nun war da der alte, berühmte Lassen, welcher hinfällig und halb erblindet in seiner Wohnung drei Treppen hoch die Elemente des Sanskrit vor einem kleinen, bald auf wenige Teilnehmer sich beschränkenden Kreise lehrte. Ich ging einige Male hin und blieb dann wieder längere Zeit weg, denn was sollte ich mit einer Sprache anfangen, von der ich keinen einzigen Text besaß und so nicht einmal in der Lage war, mich auch nur im Lesen der Buchstaben zu üben. Nach längeren Wochen stieg ich einmal wieder zu Lassen hinauf und sah in den Händen der Zuhörer ein gelbes Heft, enthaltend die erste Lieferung der eben damals von Gildemeister neu herausgegebenen Lassenschen Anthologie. Der Anblick dieses Buches und die Interpretation eines indischen Märchens, mit der Lassen soeben begonnen hatte, reizten mich aufs höchste; ich verschaffte mir die neu erscheinenden Bogen und Bopps Grammatik, und so lernte ich in diesem ersten Semester wenigstens das Lesen. Immer mehr fesselte mich das Sanskrit; im Sommer 1865 hörte ich bei Gildemeister nochmals Grammatik, im Winter darauf lasen wir bei ihm die leichteren Stücke der Anthologie, während ich bei Lassen als einziger Zuhörer den Nala trieb, mit großem Genuß, da das gebrechliche alte Männchen immer bereit war, schmunzelnd und hüstelnd alle meine Fragen über die indische Welt aus dem unerschöpflichen Schatze seines Wissens zu beantworten. So habe ich die meiste Zeit dieser drei ersten Semester mit Hebräisch und Sanskrit vertan. Letzteres trieb ich mit nicht ganz gutem Gewissen, da ich, wie damals die Dinge lagen, das Sanskrit als ein reines Luxusstudium, als eine völlig brotlose Kunst ansah und ansehen mußte. Im Sommersemester wurde der mit mir von Pforta her bekannte Machenhauer mein Stubennachbar, der, arm wie er war, seinen Unterhalt mit Stundengeben in dem Institut erwarb, welches Mr. Perry in der Poppelsdorfer Allee unterhielt. Auch mich führte er dort ein, und auf die Empfehlung Schaarschmidts hin wurde ich im Sommer 1865 mit der Aufgabe betraut, einem vornehmen, etwa 25jährigen jungen Engländer, der seine Examina für Indien gemacht hatte und im Lateinischen durchgefallen war, lateinische Nachhilfestunden zu geben, für welche ich, da er sehr weit weg bei Poppelsdorf wohnte, fünfzehn Groschen berechnete und erhielt. Mit Freuden wanderte ich dorthin und zitierte vor Machenhauer den Vers:
Now is the winter of our discontent
Made glorious summer by this son of York.
In der Tat war dieser Lord von York nicht nur ein Edelmann, sondern auch ein wirklicher Gentleman. Obwohl er mehrere Jahre älter als ich war, so empfing er mich immer mit großer Zuvorkommenheit, und als er schließlich nach England zurückging, faßte er meine Hände, wollte sie gar nicht wieder loslassen und ergoß sich in einer Flut von Dankbezeugungen. Öfter gegen Ende der Stunde kam der Prinz von Wales, der jetzige König von England, welcher damals in Bonn studierte, mit seinem großen Hunde herein, um meinen Schüler, der sein Freund war, zum Spaziergang abzuholen. Er warf sich dann in der entgegengesetzten Ecke des geräumigen Salons auf ein Sofa und hörte dem Unterrichte zu. Ein Honorar habe ich von ihm nicht erhoben. Wohl aber pflegte, wenn er zugegen war, Mr. York mich am Schluß der Lektion öfter zu fragen: »Hab‘ ich meine Sache gut gemacht?« und freute sich dann, wenn ich ihm das wirklich wohlverdiente Lob spendete. Ein anderes Geschäft brachte mich im Sommer 1865 in Verbindung mit dem hohen preußischen Adel. Ein junger Borusse hatte eine Doktordissertation über den deutschen Ritterorden geschrieben, auf deutsch natürlich, und wandte sich, da alle Dissertationen damals lateinisch eingeliefert werden mußten, an den Professor N., und dieser beauftragte mich damit, unter seiner Oberaufsicht die Arbeit zu übersetzen. Zunächst die ersten Seiten als Probe. Dies geschah, der Borusse holte das Spezimen bei mir ab und brachte es zu N., kam aber einige Tage darauf wieder, und mit Verdruß sah ich, wie mein ganz gutes Latein von N. überall korrigiert worden war. Bestürzt eilte ich zu ihm hin, er versicherte mir, daß meine Übersetzung ganz gut gewesen sei, daß sich aber dies und das in seiner Fassung noch besser ausnähme. Er forderte mich auf, ruhig so fortzufahren und hat dann auch im folgenden nicht mehr viel zu korrigieren gefunden. In meiner Unschuld kam ich nicht darauf, daß der reiche Borusse außer den dreißig mir zukommenden Talern doch wohl auch noch die höhere Stelle zu honorieren hatte, an welcher man denn auch dafür etwas geleistet haben wollte. Wenn man bedenkt, daß ich in den ersten drei Semestern zu Bonn meine Zeit zu Anfang durch das Verbindungswesen, dann durch das Schwanken zwischen Theologie und Philologie, durch die Beschäftigung mit dem Hebräischen und Sanskrit und durch die erwähnten Nebenbeschäftigungen zersplitterte, so wird man sich nicht wundern, daß ich diese ersten Semester zwar nicht wie andere verbummelt, aber doch in planloser Tätigkeit verzettelt und in literarischen Feinschmeckereien vernascht hatte, und so hatte ich bis Ostern 1866 weder an Kenntnis noch Charakter sonderlich gewonnen. So kam ich in die Osterferien nach Hause; meine Sachen standen in Bonn gepackt und warteten nur auf meine Weisung, um nach Leipzig zu gehen, wohin ich Nietzsche zu folgen gedachte. In Oberdreis traf ich mit meinem Bruder Johannes zusammen, der in Tübingen Theologie studierte und auch dorthin zurückkehren wollte. Er bot alles auf, auch mich dorthin zu ziehen, um es noch einmal mit der Theologie zu versuchen. Die Eltern waren diesem Plane sehr günstig, die Öde der heutigen philologischen Mikrologie und anderseits die Liebe zu einem freien wissenschaftlichen Studium der Bibel, das alles bestimmte mich schließlich in dem denkwürdigen Sommer 1866 nicht Philologie in Leipzig, sondern Theologie in Tübingen zu studieren.
Das in Tübingen verbrachte Sommersemester 1866 bildet in meinem Leben einen geschlossenen Abschnitt für sich, ich könnte sagen eine Oase in der Wüste oder vielleicht richtiger ein Wüstenfleck im fruchtbaren Lande. Hier war ich Theolog und nur dieses.
Außer bei Köstlin Shakespeare hörte ich nur Theologika, Ethik, Apostelgeschichte und Epheserbrief bei Beek, Matthäus bei Waidbrecht, schließlich auch nachträglich hinzutretend Kirchengeschichte bei Weizsäcker. Sogar das Sanskrit ruhte vollständig; nicht einmal Roth habe ich gehört, nachdem ich in seiner Religionsgeschichte eine Stunde lang hospitiert und den Eindruck hatte, daß der Vortrag sehr durcheinandergeworfen sei. Die alte Tübinger Schule war so gut wie erloschen und klang nur bei Waidbrecht und Weizsäcker noch einigermaßen nach; die erste Rolle spielte der charaktervolle, aber mystisch angehauchte und im Grunde sehr wenig wissenschaftliche Tobias Beek. Er wußte jeden Widerspruch mit einem gewichtigen »so ischts« zu beseitigen. Zu Beeks Füßen saßen Hunderte verehrungsvoller gläubiger Jünger. Den größten Teil bildeten Norddeutsche. Mein Bruder, ferner der charaktervolle Bleyer, der gutherzige Schwalfenberg, der gemütliche Hörter, diese und andere auf den Gymnasien zu Elberfeld und Gütersloh für die theologische Laufbahn vorgedrillten Jünglinge bildeten meinen nächsten Umgang, und bald kam ich mir vor unter ihnen wie eine Krähe unter den Tauben. Meine Anschauungen waren den ihrigen so sehr entgegen, daß eine Verständigung ganz unmöglich wurde. Ich brauchte nur den Mund zu öffnen, so pickten sie schon auf mich los, und eine Zeitlang hing ich mich an einen Juden namens Stern, der mich jedoch mit seinem krassen Materialismus schließlich noch mehr abstieß, als jene Lämmer aus Beeks theologischem Schafstall. Einige Zeit lang hielt ich Freundschaft mit einem süddeutschen Juristen, Landerer, den ich auf eigentümliche Weise verlor. Der Krieg war ausgebrochen, und er wurde nicht müde, bei unsern häufigen Zusammenkünften die völlige Niederlage Preußens vorauszusagen. Jedesmal hatte er eine Nachricht bei der Hand, daß die Preußen wieder da oder dort geschlagen worden, und das Merkwürdige war nur, daß sie trotz dieser fortwährenden Schlappen immer tiefer in Böhmen einrückten, bis dann der 3. Juli mit Königgrätz keinen Zweifel mehr bestehen ließ. Ob Landerer auch diesen Tag als einen Sieg seiner Partei auszulegen wußte, weiß ich nicht, denn seit jenem Tage mied er mich sichtlich, und wir kamen ganz auseinander. Unsere Lage im feindlichen Lande war in dieser Periode seltsam genug und verdient eine nähere Beleuchtung. Bis Pfingsten ging noch alles ziemlich gut. Überall stießen wir auf einen grimmigen Haß gegen Bismarck, und auch ich hielt ihn für einen waghalsigen und gewalttätigen Abenteurer. Der politische Horizont fing schon an sich zu trüben, aber wir glaubten nicht, daß es sobald ernst werden sollte, und unternahmen während der Pfingstferien mit beschränkten Mitteln, aber fröhlich im Jugendmute eine Fußtour in den Schwarzwald.
In Tübingen erwarteten uns schlimme Nachrichten. Der Krieg mit Österreich war in sicherer Aussicht, und wir erhielten von unserm Bezirkskommando in Neuwied die strikte Order, uns an dem und dem Tage in Neuwied zur Musterung zu stellen. Zugleich sandten die Eltern das nötige Reisegeld. Diese Aufforderung zu einer weitern Reise mitten im Semester kam uns höchst ungelegen; und wir wurden bei der Behörde dahin vorstellig, daß es uns gestattet sein möge, statt in Neuwied in dem benachbarten Hechingen uns zu stellen. Dies wurde bewilligt, aber nicht ausgeführt, denn als der Termin herankam, war das benachbarte Hechingen mitsamt der Stammburg der Hohenzollern von den tapferen Württembergern, wenn auch ohne Blutvergießen, so doch übrigens in aller Form, erobert worden. Wir waren also nunmehr in Feindesland, wurden, wenn man uns an der Sprache als Norddeutsche erkannte, beschimpft und mußten Schlimmeres gewärtig sein. Natürlich regte sich in uns denn auch der Patriotismus, wir hatten Zusammenkünfte im Weinheimer Kneiple und zogen dann wohl, geschützt durch die nächtliche Einsamkeit der Straßen, sowie durch unsere große Zahl in Tübingen mit dem Abbrüllen »Ich bin ein Preuße« und ähnlichen schönen Liedern in Tübingen ein, der Verwünschungen lachend, die man uns zurief. Unter diesen Störungen ging das kurze Sommersemester in Tübingen zu Ende, sein Resultat war, daß ich von allen theologischen Gelüsten fürs erste gründlich kuriert war. Dazu hatten Beeks orthodoxer Mystizismus, die engherzige Haltung der Kameraden wie auch die Mahnbriefe Nietzsches gleichmäßig das ihrige beigetragen. Nach Tübingen zurückkehren wollte ich nicht. Nach Leipzig zu grammatischen und textkritischen Studien zog es mich auch nicht, und so beschloß ich, noch für ein Semester nach Bonn zurückzukehren. Dort traf ich mit Tante Elise Brüning zusammen und hatte mit ihr ein ernstes und folgenreiches Zwiegespräch. Klar, bestimmt, energisch wie sie war, hielt sie mir das Charakterlose meines Schwankens zwischen Theologie und Philologie vor, und das Resultat war, daß ich mich nunmehr in der philosophischen Fakultät immatrikulieren ließ. Meine Eltern nahmen diese Nachricht sehr übel auf. Mein Vater schrieb mir einen Brief, in welchem er, an Jesaias 1 anknüpfend, das Thema variierte: »Der ganze Kopf ist wund, der ganze Leib ist krank.« Ich aber ging meinen Weg schon etwas sicherer als in den ersten drei Semestern. Bei Gildemeister, der gar nicht wußte, welches Gesicht er aufsetzen sollte, als ich ihm von meiner Tübinger Irrfahrt erzählte, nahm ich das Sanskrit wieder auf, und wir haben in diesem Semester die ganze Anthologie bis zu Ende durchpräpariert. Das Verfahren war so unpädagogisch wie möglich. Gildemeister verlangte, daß wir zwei Seiten präpariert hatten, und das war bei unserer geringen Vokabelkenntnis eine Fingerarbeit, die mehrere Tage in Anspruch nahm. Zum Auswendiglernen der Vokabeln hatten wir keine Zeit, und so wurden immer wieder dieselben Vokabeln aufgeschlagen und aufgeschrieben. Ein Kolleg bei Jacob Bernays über Lukrez war nur insofern anregend, als es uns das Beispiel eines sorgfältigen und fleißigen Zusammentragens bot, und eine philosophische Vorlesung über Gott bei Schaarschmidt führte mich zu der Überzeugung, daß Philosophie, so sehr das Herz daranhing, doch etwas sei, was in meinen Kopf nicht hineingehe. Mit schmerzlicher Resignation wandte ich mich von ihr ab und klammerte mich an historische Studien an, welche wir damals in einem Seminar bei Schäfer betrieben. Ich unternahm es, als Seminararbeit das Leben des Königs Euagoras von Cypern zu behandeln, und diese Arbeit, in der ich zum ersten Male auf der Universität mich konzentrierte und eine produktive Tätigkeit übte, machte mir viel Freude und brachte mir großen Gewinn. Als älteste Quelle lag mir die Rede des Isokrates vor, welche jedoch bei dessen Neigung zum Panegyrischen nur mit Vorsicht und Kritik zu benutzen war. Sie wurde ergänzt durch die Berichte des Ephorus und Theopomp, welche aus dem Geschichtswerke des Diodor herauszuschälen waren. Auf den ersten, die Quellen durchforschenden Teil folgte dann eine mit frischen Farben ausgeführte Darstellung des Lebens des Euagoras. Diese Arbeit, welche ich später an irgend jemand verliehen und zu meinem großen Leidwesen nicht wiedererhalten habe, erfüllte mich zum ersten Male seit langer Zeit mit Zufriedenheit. Sie wurde im Seminar in der üblichen Weise besprochen, ohne daß ich bei dem Referenten wie auch bei Professor Schäfer ein tieferes Eingehen auf die Sache bemerken konnte. Dies genügte mir nicht, und ich suchte Schäfer in seiner Wohnung auf. Ich sprach: »Es ist mir sehr wichtig, über den Wert der Arbeit aufgeklärt zu werden, da ich große Neigung habe, bei den geschichtlichen Studien zu bleiben, und wissen möchte, ob ich Beruf zu ihnen habe.« Schäfer wußte an der Arbeit nichts auszusetzen, spendete ihr aber nur kühles reserviertes Lob, so daß ich, von ihm hinausgehend, ebenso klug war wie vorher.
Die Osterferien 1867 verbrachte ich zu Oberdreis damit, die Annalen des Tacitus von Anfang bis zu Ende durchzulesen. Diese Lektüre fesselte mich mit einer fast dämonischen Gewalt, und doch wurde meine Stimmung dadurch eine so düstere, wie ich sie im Jahre vorher empfand, als ich auf der Pfingstreise längere Tage nichts außer den dunklen Tannen des Schwarzwaldes zu sehen bekam.
Ich war froh, als die Osterferien zu Ende gingen, und nun verließ ich das einsame Heimatdorf und bezog mit hochgespannten Hoffnungen im April 1867 die Universität Berlin.
Berlin war mir nicht ganz unbekannt; dort hatte ich von Schulpforta aus in den Weihnachtsferien 1861 meinen Bruder Werner, damals Studierenden an der Gewerbeakademie, besucht. Er bewohnte ein Zimmer östlich vom Alexanderplatz zusammen mit einem andern Studierenden namens Seibel, welcher einem extremen Pietismus verfallen war und meinen Bruder ganz in diese Richtung hereinzuziehen suchte. Allmorgendlich wurden Bibellesen und Gebetsübungen eifrig betrieben, bis dann die Geschäfte des Tages uns nach verschiedenen Richtungen auseinanderzogen. Den Morgen verbrachten Werner und ich gewöhnlich in den Museen. Mit dem Katalog in der Hand gingen wir von Statue zu Statue, betrachteten mit Ehrfurcht die Originale des alten Museums und ergänzten ihre Kenntnis durch die reiche Sammlung der Gipsabgüsse, welche das neue Museum enthielt. Kaulbachs Wandgemälde im Treppenhause weckten unsern Sinn für die Kulturgeschichte der Menschheit, und noch erinnere ich mich, wie wir bei den assyrischen Bildwerken mit den Inschriften, deren Entzifferung damals noch nicht gelungen war, die Bekanntschaft eines jungen Gelehrten machten, welcher eifrig an den Keilschriften studierte und in ihnen die semitische Pluralendung rm entdeckt zu haben glaubte. Ein andermal wanderten wir nach Charlottenburg, um die Denkmäler des Mausoleums zu besuchen. Ermüdet und durchkältet kehrten wir in einem Wirtshaus der Berliner Straße ein, tranken ein Glas Punsch und verzehrten eine größere Anzahl der »Berliner Pfannkuchen«, wodurch unser Portemonnaie in dem Maße leichter wurde, in welchem der Magen das behagliche Gefühl der Sättigung empfand. Auch diese Tatsache erzählte ich später in Pforta, natürlich um interessant zu erscheinen, mit der nötigen Übertreibung, wodurch sich dann Freund Guido Meyer, ein vortrefflicher Karikaturenzeichner, veranlaßt sah, unter anderm dieses Abenteuer durch Abbildungen zu verherrlichen nebst erläuternden Versen, deren einer lautete:
Pfannkuchen schlang er fleißig
Und hatte nicht genug,
Bis endlich ihrer dreißig
Im Bauch er mit sich trug.
Übrigens konnten wir den Verlust verschmerzen, da Mama in liebender Fürsorge zu unserm monatlichen Budget noch fünf Taler gefügt hatte, um in dem Genuß unserer Ferien nicht allzu eingeschränkt zu sein.
Wohl nie hat eine bescheidene Summe wie diese bessere Früchte getragen. Allabendlich, soweit es die Kasse erlaubte, besuchten wir die Theater, sahen vom Olymp herab für 50 Pfennig im Königlichen Schauspielhause die Waise von Lowood mit Hendrichs, bewunderten im damaligen Wallnertheater Helmerding in »Berlin, wie es weint und lacht«, und die Krone dieser Genüsse war eine durch den Eintrittspreis von 75 Pfennig und stundenlanges Warten vor der Kasse erkämpfte Vorstellung des Troubadour im Königlichen Opernhause, bei welcher die schon längst berühmte Lucca mit der als 16jähriges Mädchen ihre ersten Triumphe feiernden Adelina Patti zusammen wirkte.
So war ich denn kein Fremdling in Berlin, als ich im April 1867 dort eintraf, um meine Studien an der Universität fortzusetzen und, wie ich hoffte, zu beschließen. Zunächst wohnte ich in der Leipziger Straße, wo jetzt das Warenhaus von Wertheim steht, doch wechselte ich bald und bezog ein besseres Zimmer in der Schöneberger Straße 30 zwei Treppen hoch bei der trefflichen Frau Walter. Diese Familie lebte in großer Armut. Der Vater, ein Zimmergeselle, mochte kaum so viel verdienen, um die mit sieben lebendigen Kindern gesegnete Familie zu unterhalten. Sie wohnten alle zusammen in der Küche und einem Hinterraum, und öfter sah ich, von dem Eingang in mein Zimmer in die nur durch einen Bretterverschlag getrennte Küche hineinblickend, wie die Kinder, auf den Stühlen umherliegend, eingeschlafen waren. Das jüngste Kind erkrankte und starb. Am folgenden Tag kam mein Freund Bodenstein, mich zu besuchen, und fragte: »Was ist denn bei Frau Walter los?« Ich hörte die Kinder jubeln: »Der Sarg ist da! Der Sarg ist da!« Die armen Kinder freuten sich, ihr Schwesterchen wenigstens in einen schönen neuen Sarg gebettet zu sehen. In dieser Wohnung blieb ich ein volles Jahr, da ich sie aus den Herbstferien 1867 von Oberdreis zurückkehrend frei fand und wieder bezog. Weihnachten 1867 war gekommen. An eine Christbescherung konnte die arme Familie Walter nicht denken. Da beschloß ich einzuspringen. Einen Taler konnte ich allenfalls entbehren. Ich kaufte am 24. Dezember, wo alles schon billig geworden ist, für 50 Pfennig ein hübsches Christbäumchen, schmückte es für weitere 50 Pfennig mit Hilfe von Bodenstein auf das zierlichste aus und behielt noch Geld genug übrig, um Äpfel, Nüsse, Backwerk und sechs kleine Geschenke zu kaufen und sie auf sechs Tellern um den Christbaum herum zu gruppieren. Die Lichter wurden angezündet, die Kinder hereingerufen; selten habe ich frohere Kindergesichter gesehen, selten ein schöneres Weihnachtsfest verlebt als dieses.
Geben ist seliger als Nehmen, wie Epikur, der große Lehrer irdischer Glückseligkeit, und Jesus, der Pfadfinder der Erlösung, in merkwürdiger Übereinstimmung gesagt haben. Außer dem genannten und schon länger verstorbenen Bodenstein war mein nächster Umgang Freund Adolf Textor. Wir drei hatten schon in Pforta als Tertianer zusammengehalten, waren oft zu dem Walde des Knabenberges hinaufgestiegen, um, auf Bodensteins Plaid gelagert, dem verbotenen Genuß des Rauchens zu frönen, und so bildeten wir auch in Berlin einen engeren Kreis, an den sich gelegentlich manche andere anschlossen. Bodenstein, nach seiner äußeren Erscheinung klein, zart und fein gebaut, besaß einen klaren, sarkastisch einschneidenden Verstand, daneben aber eine stark entwickelte Sinnlichkeit, welche seine Gesundheit frühzeitig untergrub und den Fortgang seiner Studien behinderte. Er bestand seine Examina später nur zur Not und hatte dann eine bescheidene Lehrerstelle in Merseburg, seiner Heimat, gefunden, wo ich ihn fünfzehn Jahre später schon leidend und hinfällig kurz vor seinem Tode mit Textor zusammen besuchte. Textor, obgleich auch nicht sehr kräftig, hatte viel Humor und trieb seine Studien mit wirklichem Interesse. Wir haben all unser Leben treu zusammengehalten, sind zusammen gereist, haben uns oft gegenseitig besucht, 1873 in Genf, 1903 in Rom getroffen, immer wirkte der Verkehr mit ihm auf mich anregend und belebend, und so war er denn auch 1867 in Berlin ein treuer Kamerad, wir hörten zusammen dieselben Vorlesungen und verkehrten außerhalb derselben täglich miteinander.
Unter den damaligen Vorlesungen an der Berliner Universität übte eine besondere Anziehungskraft die Interpretation der alten Klassiker durch Moriz Haupt. Sein Vortrag war lebendig, mitunter witzig und hatte von Lachmann die kritische Schärfe sowie die Grobheit in der Polemik gegen andere Philologen. Gewöhnlich wählte er sich unter ihnen einen Prügelknaben; im Katull war es »Herr Hertzberg«, im Sophokles »Herr Nauck«, deren Erklärungen und Konjekturen er jämmerlich zu zerfleischen wußte, um dann seine eigenen Auffassungen mit einer Zuversicht zu verkünden, welche oft zu ihrem Werte in keinem richtigen Verhältnis stand. Einige Wochen hindurch fanden wir dieses Verfahren sehr amüsant, bald aber regte sich auch in uns der kritische Geist, und ich erinnere mich, wie ich nach der Vorlesung mit einigen Kameraden im Vorgarten der Universität die Methode Haupts auf seine eigenen Erklärungen und Verbesserungen anwendete und nicht ohne Glück bewies, wie dieselben kaum weniger fragwürdig seien als die seiner Gegner. Neben Haupts Kollegien hörte ich noch bei Rödiger die Psalmen und mußte mich überzeugen, wie auch in ihnen viele Stellen fraglich sind und dunkel bleiben. Bei Weber hatte ich die Sakuntala belegt, war auch so glücklich, ein in indischer Weise oblong und schlecht gedrucktes Exemplar für drei Mark zu erwerben, mußte aber dann doch auf das Hören dieser Vorlesung verzichten, da ich zum Präparieren kein Wörterbuch besaß und auch nicht die Mittel, mir ein solches anzuschaffen. Besonders anregend war auch eine Vorlesung von Werder, er nannte sie »Logik und Metaphysik«, in Wahrheit war sie weder das eine noch das andere, sondern bestand in einer lebendigen, klaren und mit Beredsamkeit vorgetragenen Darstellung der Hauptlehren von Kant, Schopenhauer und Hegel. Diese Vorlesung hatte das Verdienst, mir das in den Bonner Vorlesungen abhanden gekommene Bewußtsein beizubringen, daß Philosophie etwas sei, welches von jedem normalen Kopf und so auch von mir verstanden werden könne. »Es ist von Menschen geschrieben und für Menschen geschrieben und kann auch von solchen verstanden werden«, wie Werder nicht müde wurde zu wiederholen.
Mit diesen Eindrücken kehrte ich im August 1867 für die Herbstferien nach Oberdreis zurück.
Wie gewöhnlich in den Ferien, wurde auch dieses Mal fleißig gearbeitet. Zunächst hatte ich Shakespeares Richard III. auf englisch genau durchgearbeitet und mich dann dem Platon zugewendet, dessen Protagoras und Gorgias mich so sehr fesselten, daß ich mir vornahm, mich in den Platon hineinzulesen und mit dieser frohen Aussicht in der zweiten Hälfte des Oktobers nach Berlin zurückkehrte. Ich bezog wieder mein Zimmer bei Frau Walter, belegte bei Haupt, Kirchhoff u.a. die üblichen Vorlesungen, benutzte mäßig die Gelegenheit, welche Berlin für die Ausbildung im Verständnis für bildende Künste und Musik bot, und freute mich, den alten Freunden wieder zu begegnen. Bald aber wurden alle diese Interessen durch ein einziges zurückgedrängt, das Studium des Platon. Von Pforta her besaß ich noch die Teubnersche Ausgabe in sechs Bänden, und jetzt fing ich mit dem ersten an, um mich durch sämtliche Werke in der Reihenfolge der Tetralogien des Thrasyllus durchzuarbeiten. Ein wahrer Furor Platonicus ergriff mich; mit einer Begeisterung, wie ich sie nie gekannt, mit einer Beharrlichkeit, wie ich sie nie geübt, las ich vom Morgen bis zum Abend auf dem Sofa liegend, mit einem Lexikon neben mir, den Platon. Mit dem Gedanken an ihn stand ich auf und ging zu Bett, ließ Vorlesung Vorlesung sein, ließ die Sonne aufgehen und untergehen, und las meinen Platon. Im Februar 1867 hatte ich ihn ganz durchgelesen und hätte am liebsten damit gleich wieder von vorne angefangen, aber der Gedanke an das Doktorexamen veranlaßte mich, meine Studien auf einen einzelnen Dialog zu konzentrieren, und dieses sollte nach meiner damaligen Absicht der von Geist und Humor übersprudelnde, aber keinen allzu reichen positiven Inhalt bietende Euthydemus sein. Inzwischen schrieb ich an die Eltern: »Liebe Eltern, ich bin jetzt im schönsten Zuge der Arbeit und hoffe nach einem halben Jahre hier in Berlin mein Doktorexamen abzulegen.« Aber die Antwort lautete: »Lieber Sohn, Du hast jetzt sieben Semester auf drei Universitäten studiert und Geld genug gekostet. Willst Du noch weiter studieren, so komme nach Oberdreis, wir wollen Dir ein Zimmerchen einrichten und Dich gutpflegen. Deine Examina kannst Du dann von hier aus machen.« Was war zu tun, ich mußte wohl oder übel gehorchen. Mit Schmerzen sagte ich dem geliebten Berlin und seinen Kunstschätzen Lebewohl; eben da, als Auge und Ohr für deren Verständnis sich zu öffnen anfingen, verließ ich die Großstadt mit ihrem lärmenden und für mich so anregenden Treiben und siedelte Ostern 1868 mit Sack und Pack in mein einsames Heimatsdorf über, um dort bis Ostern 1868 ein volles Jahr zu verbringen.
Dieses Jahr steht vermöge seiner äußeren Vereinsamung und seiner inneren Fruchtbarkeit in meinem Leben fast einzig da. Ich wurde freundlich aufgenommen und gut gepflegt, aber mein an die städtische Kost gewöhnter Magen konnte die ländliche, überwiegend aus Pflanzenkost bestehende Nahrung und das schwerere Landbrot nur schlecht vertragen. Ein Übermaß von Magensäure machte mir das ganze Jahr zu schaffen und wich erst, als ich Ostern 1869 wieder in städtische Verhältnisse trat. Auch die Heiserkeit, die ich mir schon im Jahre vorher durch unsinniges Vorlesen von Dramen zugezogen hatte, bestand das ganze Jahr hindurch und quälte mich um so mehr, je größer all mein Leben lang bei mir das Bedürfnis gewesen ist, mich andern mitzuteilen. Freilich war dazu in dem engen Kreise des Vaterhauses keine besondere Veranlassung. Mein Vater hat sich nie eingehend mit uns befaßt; es schien, als wenn er an seinen Kindern kein besonderes Interesse nähme, obgleich meine Mutter, wenn ich ihr erklärte, daß wir ohne sie nicht soweit gekommen sein würden, dieses bescheiden abzulehnen pflegte und behauptete, daß es immer Papa gewesen sei, welcher den Mut gehabt und ihr eingesprochen habe, die vielen Kinder unter so engen und schwierigen Verhältnissen zu einer anständigen Lebenslage auszubilden. Wieweit dies zutrifft, vermag ich nicht zu beurteilen; Tatsache ist, daß die Mutter für uns immer im Vordergrunde stand, und so war es auch in dem einsamen Studienjahr in Oberdreis. Sie pflegte mich sorgsam, aber der geistige Verkehr wurde dadurch sehr eingeschränkt, daß wir nur zu leicht auf religiöse Themata kamen und uns hier nicht mehr verstanden. Zwar hatte meine Mutter die engen Anschauungen ihrer Elberfelder Mädchenzeit im Verkehr mit den von Schule und Universität zurückkehrenden Söhnen allmählich abgelegt und versuchte zu freieren religiösen Anschauungen durchzudringen, und wenn sie in früheren Zeiten gelegentlich den Ausspruch des alten emeritierten Pastors Neumann, Karl Reinhardts Großvater, zu zitieren pflegte: »Schiller und Goethe in den Ofen!«, so kam es jetzt wohl vor, daß sie sich in einer stillen Abendstunde mit mir an einem Stück von Shakespeare oder Goethe erbaute; aber um so mehr war sie geneigt, auf religiöse Themata das Gespräch zu lenken, und um so deutlicher fühlten wir beide den weiten Abstand, der zwischen unsern Anschauungen bestand, und zogen es schließlich vor, derartigen Gesprächen ganz aus dem Wege zu gehen.
Meine Arbeit fesselte mich vom frühen Morgen bis zum späten Abend und wurde nur durch einen längeren Spaziergang mittags nach Tisch unterbrochen. Während des Sommers ging oder vielmehr lief ich eine Zeitlang täglich nach Altenkirchen, wobei ich Hin- und Rückweg durch teilweises Laufen von drei Stunden auf zwei zu reduzieren wußte. Man wunderte sich über die Zähigkeit meiner Natur, mit der ich, auch in der größten Mittagshitze, diesen weiten Weg so schnell zurücklegte und dann sofort wieder bei der Arbeit saß, während mein Vater an den heißen Nachmittagen wiederholt durch mein Arbeitszimmer in das Schlafzimmer ging, um trockene Wäsche anzulegen und sein Erstaunen darüber ausdrückte, daß die furchtbare Hitze mich und meine Arbeit nicht im mindesten anzufechten schien. Der Herbst kam, und mit ihm kühlere Tage. Täglich beobachtete ich, wie die Sonne einen kleineren Bogen am Himmel beschrieb, wie die Blätter welkten und fielen, die Novemberstürme über das Dorf wegbrausten und schließlich der Schnee die erstorbene Natur wie mit einem weißen Leichentuche überdeckte. Ich beschränkte jetzt meine täglichen Spaziergänge auf das eine halbe Stunde entfernte Steimeln, wo ich einen Tag wie den andern ein Glas abgestandenen Bieres trank, eine Zigarre dazu rauchte und dabei die Neuwieder Zeitung las, in welcher unterm Strich gerade eine der fürchterlichsten Mordgeschichten in täglichen kleinen Rationen verzapft wurde. Die Atmosphäre des Dorfwirtshauses, der Geruch von Bier und Tabak verband sich mit dem Blutgeruch, den die Geschichte ausströmte, zu einem Eindruck, welcher um so tiefer sich einprägte, je regelmäßiger er derselbe war.
Inzwischen schritt die Arbeit an meiner Doktordissertation, ungestört durch äußere Eindrücke, rüstig weiter. Ich hatte, wie schon bemerkt, zunächst den Euthydemos des Platon ins Auge gefaßt, fand aber nach einiger Zeit, daß er doch für eine so intensive Beschäftigung zu wenig Inhalt bot, und ging, als ich meine Kräfte wachsen fühlte, nicht ohne Bedenken, ob ich auch der Aufgabe genügen könne, dazu über, einen der schwierigsten und inhaltreichsten Dialoge des Platon, den Sophista, zum Gegenstand meiner Bemühung zu machen, und noch heute muß ich es zu den glücklichsten Fügungen meines Lebens rechnen, daß ich, wie im Jahre 1880 den Çankara so 1868 den Sophista vornahm, um mich mit aller Kraft meiner Seele ganz in ihn hineinzuleben. Mit Fernhaltung alles dessen, was über den Sophista vor mir geschrieben war, vertiefte ich mich in den griechischen Text, nicht so, daß ich ihn auswendig lernte, sondern mehr als das, so daß ich den ganzen Gang der Gedanken auf das lebendigste mir aneignete und mit jeder einzelnen Wendung derselben genau Bescheid wußte. Und nachdem ich ihn so in mir aufgenommen hatte, brütete ich darüber, saß davor wie vor einem verdunkelten Gemälde, dessen Züge man zu erkennen sucht, ohne daß es mir fürs erste gelingen wollte, den eigentlichen Sinn und Zweck des Ganzen zu erfassen. Dieser stellte sich eines Tages bei einem Spaziergange auf den Oberdreiser Berg, fast plötzlich, wie ein Kristall anschießt, gleichwie eine Eingebung bei mir ein. Mit einem Male war mir alles klar, der Grundgedanke und alle Einzelheiten, welche auf ihn wie Strahlen auf einen gemeinsamen Mittelpunkt hinwiesen, oder vielmehr von ihm ausgingen. Ich erkannte, daß Platon mit Parmenides, dem größten seiner Vorgänger, Abrechnung hält und zeigt, wie das unwandelbare Eine des Parmenides bei genauer Betrachtung sich zur Vielheit der platonischen Ideenwelt entfalten muß. Er zeigt dies aber nicht durch eine abstrakte Beweisführung, sondern, indem er uns einen eleatischen Gastfreund vorführt, welcher, von Sokrates aufgefordert, sich über das Wesen des Sophisten zu äußern, aus einer Verlegenheit in die andere gerät und schließlich damit endet, sich vor unsern Augen aus einem Parmenidäer zu einem Platoniker fortzuentwickeln. Erst nachdem ich diesen Aufschluß durch bloße, hingebende Betrachtung des griechischen Textes gewonnen hatte, nahm ich die Literatur über Platon zur Hand, welche ich mir fast vollständig von Schleiermacher an bis zu Schaarschmidt hin zu verschaffen gewußt hatte, ging mit der Feder in der Hand der Reihe nach durch, was alle jene Vorgänger über meinen Dialog gesagt hatten und machte dabei die niederdrückende Erfahrung, daß sie alle um die Sache herumgingen, bald diese, bald jene Seite an ihr hervorkehrend, und daß keiner bisher den eigentlichen Kernpunkt getroffen hatte. Am nächsten war ihm unerwarteterweise noch Stallbaum gekommen, der unter dem Schwall seines redseligen, ja geschwätzigen Lateins mitunter einen ganz gesunden Sinn verrät. Ich will nicht verbergen, daß diese Eindrücke wesentlich dazu beitrugen, mich zwar nicht von dem klassischen Altertum, dem ich all mein Leben mit größter Liebe zugetan gewesen bin, wohl aber von der klassischen Philologie weg und auf ein Gebiet hinzuführen, wo nicht jede große Erscheinung von einem solchen Kometenschweife modernen Geredes begleitet wird, sondern ein Urwald der Bearbeitung harrt, bei welcher jeder Schritt lohnend ist, ohne daß man die unfruchtbare Arbeit zu leisten hat, die ganze moderne Literatur über den Gegenstand, wenn auch nur zum Schein, zu berücksichtigen. –
Nunmehr schritt ich, es war im Oktober 1868, zur Ausarbeitung meiner Dissertation, welcher ich in ländlicher Abgeschiedenheit so recht con amore mich ganz hingeben konnte. Der Plan meiner ganzen Arbeit stand mir fest, Stück für Stück arbeitete ich ihn aus, indem ich mir bei jedem Abschnitte erst einen genauen Entwurf machte und dann seine Ausführung in sauberstem Latein zu Papier brachte. So entstand diese Erstlingsarbeit, auf die ich noch jetzt nach 40 Jahren mit Befriedigung und Freude zurückblicke. Der 10. Dezember war der große Tag, an welchem ich das meine Dissertation enthaltende Paket in Altenkirchen auf die Post gab, und zwar an die philosophische Fakultät in der damals schon preußischen Universität Marburg. Ich hatte zwar hier nicht studiert, war aber an allen drei Universitäten Bonn, Tübingen und Berlin keinem meiner Lehrer so nahe getreten, daß ich ein Interesse für mich bei ihm hätte voraussetzen können, und so zog ich dem halben Bekanntsein das gänzliche Unbekanntsein vor und wandte mich nach Marburg, zumal auch dort die Promotionsgebühren um einiges geringer waren als an den andern Universitäten. Im folgenden Monate unternahm ich dann die Reise nach Marburg, um bei meinen künftigen Examinatoren, namentlich den klassischen Philologen C. Julius Cäsar und Leopold Schmidt, mich vorzustellen und das Terrain zu rekognoszieren. Man nahm mich als einen Fremden mit vorsichtiger Zurückhaltung, aber nicht unfreundlich auf, und ich kehrte mit gutem Mute nach Oberdreis zu meiner Arbeit zurück. Schon während der Ausarbeitung meiner Dissertation hatte ich die Vorbereitung auf die mündlichen Fächer, Griechisch und Lateinisch, nebst alter Geschichte als Nebenfach, und dazu Philosophie getroffen und freute mich, nach Ablieferung meiner Dissertation einige Monate hindurch meiner allgemeineren Ausbildung und der Ausbreitung meiner Kenntnisse über so viele interessante und wissenswerte Gegenstände widmen zu dürfen.
Bei dieser Gelegenheit gelangte unter andern Büchern, die ich aus einer Buchhandlung in Bonn bezog, auch Schopenhauers »Welt als Wille und Vorstellung« in meine Hände. Jeder Blick in die noch ungebundenen beiden Bände brachte mir zum Bewußtsein, welch ein Schatz klarer und bedeutender Gedanken hier liege; eilig ließ ich das Werk in Altenkirchen binden und verschlang dann in kaum mehr als einer Woche den ersten, das ganze System in der Glut und Frische der ursprünglichen Konzeption enthaltenden Band. Von Tag zu Tag stieg meine Bewunderung für den herrlichen Geist, der hier zu uns redet. Bei den erkenntnistheoretischen und naturphilosophischen Betrachtungen war es mir, als wenn ein Schleier weggezogen würde, der mir bis dahin die Dinge verhüllte. Die ästhetischen Anschauungen des dritten Teiles versetzten mich in das höchste Entzücken, und noch ist mir erinnerlich, wie ich am 26. November, dem Geburtstag meines Vaters, meinen üblichen Spaziergang durch die sonnbeglänzte Schneelandschaft nach Steimeln machte und mich prüfte, ob auch ich imstande sei, mich zu jener objektiven, willensfreien Anschauung zu erheben, welche Schopenhauer so wunderbar beschrieben und durch Beispiele erläutert hat. Weniger wollte es mir mit dem vierten, die Ethik behandelnden Teile gelingen, die Verneinung des Willens zum Leben als letztes Ziel stieß mich ab, ich glaubte nur ein trostloses Nichts vor mir zu sehen und war schließlich froh, die ganze düstere Weltanschauung wie einen schweren Traum von mir abzuschütteln und mich den Forderungen des Tages zuzuwenden. So rückte der Termin der mündlichen Prüfung heran. Sie war auf den 29. Januar 1869, nachmittags 5 Uhr, anberaumt worden. Ich traf am Tage vorher gegen Abend in Marburg ein und hielt es für meine Pflicht, sofort meine Ankunft beim damaligen Dekan, dem Professor der Mathematik Stegmann, zu melden. Der Empfang war nicht gerade erfreulich. Der schwerfällige pedantische Mann kam mir mit den Worten entgegen: »Aber Herr Kandidat, wie können Sie noch so spät am Abend bei mir vorkommen.« Ich entschuldigte mich mit der Unmöglichkeit, früher einzutreffen, und der Wichtigkeit, welche die Sache für mich habe, und kehrte in das Hotel zum Ritter zurück, um eine, wenn ich mich recht erinnere, unruhige Nacht zu verbringen. Am andern Morgen besuchte ich meine Examinatoren Cäsar und Schmidt sowie Weißenborn, dem ich erklärte, mich besonders mit den drei Kritiken Kants beschäftigt zu haben, und endlich Wachsmuth, der mich in alter Geschichte als Nebenfach prüfen sollte. »Na, ich werde Sie nicht sehr quälen«, sagte er freundlich, indem er mir die Hand reichte. Schließlich erschien er gar nicht beim Examen, indem er Leopold Schmidt gebeten hatte, mich für ihn mit zu prüfen. Qualvoll waren die letzten Stunden vor dem Examen. Arbeiten wollte ich nicht mehr, Bekannte hatte ich nicht, und so irrte ich stundenlang in der fremden Stadt umher, bestrebt mich zu zerstreuen und doch immer wieder mit meinen Gedanken zu den Gegenständen des Examens zurückkehrend. Endlich schlug die Stunde des Examens, ich wurde in einen geräumigen Saal gewiesen und befand mich hier ganz allein drei oder vier Professoren gegenüber, nur durch einen grünen Tisch von ihnen getrennt. Das Examen im Griechischen und Lateinischen verlief sehr glücklich. Mit Leichtigkeit fand ich mich in den vorgelegten Stellen aus griechischen und lateinischen Schriftstellern zurecht, beantwortete die daran geknüpften Fragen in fließendem Latein und ging, durch den Erfolg immer mutiger geworden, schließlich dazu über, griechisch zu sprechen, wodurch dann auch Leopold Schmidt veranlaßt wurde, sich derselben Sprache zu bedienen. Weniger günstig verlief das Examen in der Philosophie. Weißenborn, ein alter verbohrter Hegelianer, leitete mit einer längeren Auseinandersetzung seine Frage ein, auf die man als Antwort die in seinem Kolleg übliche Formel beizubringen hatte, wodurch ich wiederholt in Verlegenheit geriet und bemerken konnte, wie meine philologischen Examinatoren auf ihren prüfenden Kollegen unwillige Seitenblicke warfen.
Zulegt, als ich schon das Bewußtsein hatte, meines Erfolges sicher zu sein, erschien noch unerwartet Brink und legte mir ein Buch vor. »Was gibt es denn hier noch?« äußerte ich in etwas übermütiger Laune. »Nur noch ein bißchen Französisch«, entgegnete der bescheidene Mann und legte mir eine Stelle vor, die ich mit Leichtigkeit übersetzte, auf die darangeknüpften Fragen mutwilligerweise in französischer Sprache antwortete und schließlich, ich weiß nicht wie, ins Englischsprechen geriet, welches alles als ein Opus supererogationis beifällig aufgenommen wurde, so daß das Examen mit Glanz abschloß. Mein Englisch stand damals noch auf schwachen Füßen. Auf der Schule wurde es nicht gelehrt, aber schon in Elberfeld hatte ich ein Büchlein von Bensch, English made easy, antiquarisch erstanden und mich unter gelegentlicher Hilfe von Ernst Schnabel, sowie der Kommis im Altgeldschen Laden privatim hineingearbeitet. Nur geringe Förderung brachte in Schulpforta ein Privatkursus, welchen Volkmann eingerichtet hatte und sehr bald wieder fallen ließ, und erst in Prima kam ich zum Lesen eines englischen Autors, und zwar des Shakespeare, um dessentwillen ich mich zum Englischen hingezogen fühlte. Ich hatte mir von meinen Ersparnissen die sieben Bände der Tauchnitzausgabe und das Lexikon von Delius angeschafft und einige Stücke gelesen. In den Ferien konnte ich dann mit Fanny Poad, einer kleinen, lebhaften Engländerin, welche als Pensionärin in unserm Hause weilte, für den Unterricht, den ich ihr im Lateinischen gab, englische Konversationsübungen eintauschen, wobei sie oft Veranlassung fand, mein »Shakespearean English« zu verbessern. Etwas günstiger stand es bei mir mit dem Französischen. Zwar der Unterricht in Schulpforta war höchst mangelhaft gewesen, da sich Koberstein die Sache allzu bequem machte. Beim Abiturientenexamen sahen wir den Übersetzungen ins Lateinische und Griechische ohne Furcht entgegen, aber keiner von uns fühlte sich imstande, auch nur eine Seite korrekt ins Französische zu übersetzen. Einen Fortschritt brachte mir die Übersetzung von Bevilles Theodor Parker, welche mir 1865 auf Empfehlung meines Onkels Friedrich Ingelbach in Paris vom Verleger Reinwald übertragen worden war, zwölf Freiexemplare und vierzig Taler einbrachte und als erste Veranlassung, mich gedruckt zu sehen, mir viele Freude bereitete. Die ersten Bogen hatte ich mit großer Mühe und Sorgfalt ausgearbeitet, und die durch sie erlangte Übung hatte es möglich gemacht, das ganze übrige Buch in verhältnismäßig kurzer Zeit herzustellen.
Schon vor meinem Doktorexamen hatte Julius Cäsar, als ich mich ihm vorstellte, mir mitgeteilt, daß am Gymnasium zu Minden für einen Probekandidaten eine mit 1200 Mark besoldete Stelle offen stehe, und daß man mich nach bestandenem Doktorexamen zu derselben empfehlen wolle; mein Staatsexamen könne ich dann im Laufe des Sommers von Minden aus machen. Mit dieser Nachricht kam ich nach Haus, und die Eltern drängten sehr, die Stelle anzunehmen. Ich hatte Bedenken, einmal weil meine Heiserkeit, die mich immer noch quälte, mir ein Lehren vor ganzen Klassen fast unmöglich erscheinen ließ, dann auch, weil ich vorher schon in Berlin um eine Inspektorstelle im Schindlerschen Waisenhause mich beworben hatte und die Antwort erst abwarten wollte. Aber die Eltern setzten mir stark zu, meine Mutter, indem sie mir vorstellte, daß ich nun endlich auf eigenen Füßen stehen müsse, mein Vater, indem er mir die Trefflichkeit des Westfalenlandes pries, und so sagte ich in Minden zu. Acht Tage später kam ein Anerbieten aus Berlin, welches mein Lebensschifflein in andere Bahnen gelenkt haben würde und jedenfalls meiner Natur besser zusagte. Es war zu spät, und ich mußte es dankend ablehnen. In dieser bewegten Zeit traf von meinem Freund Nietzsche die Nachricht ein, daß er, ohne irgendein Examen gemacht zu haben, auf Ritschls Empfehlung hin zum Professor an der Universität und dem Pädagogium zu Basel ernannt worden sei.
Ich beglückwünschte ihn, konnte aber nicht umhin, meine bescheidenen Aussichten mit seinem glänzenden Erfolg in Parallele zu stellen, wobei wohl etwas wie Neid durchgeklungen haben mag. Als Antwort auf meinen Brief traf eine Visitenkarte von Nietzsche ein, die mich auf das tiefste erschütterte. Er schrieb: »Wenn nicht etwa zufällige Störungen des Kopfes Deinen letzten Brief veranlaßt haben, so muß ich bitten, hiermit unsere Beziehungen als abgeschlossen zu betrachten.« Diese Worte brannten in meiner Seele wie höllisches Feuer. Ich war damals, wo mich Schopenhauer noch nicht freigemacht hatte, noch zu sehr befangen in den gewöhnlichen Begriffen von Ehre und dergleichen, um mir nicht sofort zu sagen, daß auf eine so deutliche Absage hin auch meinerseits ein Verzicht auf jeden weiteren Verkehr zu folgen habe.[106] Aber mein Geist konnte sich nicht in den Gedanken finden, einen solchen Freund zu verlieren. Es drängte mich, an Nietzsche zu schreiben und ihn zu fragen, wie er nur meinen Brief so habe mißverstehen können. Als Antwort sandte mir Nietzsche drei Schriftstücke: 1. meinen inkulpierten Brief, 2. einen Kommentar dazu, der ihn für ein Gemisch von Neid, Borniertheit und Bauernstolz erklärte, und endlich, als Beispiel, wie man es machen müsse, einen Brief von Erwin Rohde, der sich nicht genug tun konnte im Entzücken darüber, einen richtigen Professor, und noch dazu einen so jungen und lieben, seinen Freund nennen zu dürfen. Ich kann nicht sagen, daß ich mich über meinen Brief, der jedenfalls ein aufrichtiger Ausdruck meiner Gesinnung war, sonderlich geschämt hätte; ich dankte in meiner Antwort für die versöhnliche Gesinnung, ohne die Sache weiter aufzurühren, und zog daraus eine Lehre für die Zukunft. Ich verstand jetzt die Worte, welche Nietzsche einst an mich schrieb: »Im Ernst, mein Freund, ich muß bitten, wenn Du von mir sprichst, mit etwas mehr Respekt zu reden.«
Der Tag der Abreise nach Minden rückte heran. Ich ging meinem Schicksal mit einer gelinden Verzweiflung entgegen, denn ich glaubte vorauszusehen, daß man mich wegen meiner Heiserkeit in der allernächsten Zeit als unbrauchbar zurückschicken würde. Und ich trat meine Reise ziemlich mutlos an. Um mich für die bevorstehende Arbeit noch tunlichst zu kräftigen, beschloß ich den Weg von Oberdreis nach Minden zu Fuß zurückzulegen und habe es wenigstens zur Hälfte, etwa bis Elberfeld hin, ausgeführt. Ich wanderte den schon so oft zurückgelegten Weg von Oberdreis nach Neuwied und sodann das Rheintal hinunter. Es war ein schöner Sonntagmorgen im April, an Bäumen und Sträuchern zeigte sich das erste Grün, nah und fern tönten die Kirchenglocken, das Lied fiel mir ein, welches wir vor 14 Jahren bei unserm Lehrer Kaiser so oft gesungen hatten:
»Des Sonntags in der Morgenstund‘,
Wie wandert sich’s so schön
Am Rhein, wenn rings in weitem Rund
Die Morgenglocken gehn.«
Und neuer Lebensmut fing an, sich zu regen. Schließlich gewann ich Steele, wo mein Bruder Werner als Ingenieur in einem Werke angestellt war. Er erwartete auch den vom Predigerseminar zu Wittenberg zurückkehrenden Bruder Johannes, wir gingen am Abend, ihn von der Bahn abzuholen und beschlossen, auf seine Weltabgekehrtheit vertrauend, ihm einen kleinen Schabernack zu spielen. Werner begrüßte den Bruder und stellte mich, der ich im Halbdunkel mit etwas eingedrücktem Hute ihm zur Seite stand, als seinen Freund Herrn Müller vor. »Sehr angenehm, Herr Müller«, versetzte Johannes, reichte mir die Hand, und wir setzten uns zu dreien in Bewegung. Mit etwas verstellter Stimme knüpfte ich ein Gespräch mit Johannes an, leitete die Unterhaltung auf seinen Bruder Paul, und eben war Johannes im Begriff mit einem: »Ja, der will ja –«, ich weiß nicht was zu sagen, als wir das Lachen nicht mehr zurückhalten konnten. Johannes blieb betroffen stehn, faßte mich scharf ins Auge und erkannte seinen Bruder. Für solche Scherze war er ein dankbares Objekt. Nur einen will ich der Vergessenheit entreißen, der sich auch um diese Jahre herum zugetragen hat. Es war in Oberdreis, ich spazierte mit Johannes auf dem Wege nach Altenkirchen zu, und ich fing an zu rezitieren:
Und frische Nahrung, neues Blut,
Saug ich aus freier Welt,
Wie ist Natur so hold und gut,
Die mich am Busen hält.
»Nicht übel gereimt«, sagte Johannes. »Freilich wohl,« versetzte ich, »das Gedicht ist ja von Goethe.« »Das wirst du mir nicht aufbinden, du hast das Gedicht selbst gemacht.« Schnell entschlossen sprach ich: »Ja, ich will es nur gestehen, ich habe es selbst gemacht, ich halte es für eine meiner besseren Leistungen und möchte gar zu gern dein kritisches Urteil darüber hören.« Johannes sagte zu, wir kehrten nach Hause zurück, ich schrieb das Gedicht säuberlich ab und überreichte es dem Bruder. Am nächsten Tage stellte er es mir zurück, und wer beschreibt meine Freude, als ich sah, wie Johannes es von oben bis unten mit Bleistiftstrichen verziert hatte. Kaum eine Zeile war seiner tadelnden Kritik entgangen. Ein Gedicht, meinte er, könne unmöglich mit dem Worte »und« beginnen. Das Saugen gebe ein unschönes Bild, der Natur könne man keinen Busen zuschreiben, und so ging es weiter. Das zusammenfassende Urteil am Schluß lautete etwa: Der Verfasser ist im Dichten noch wenig geübt, offenbar ein Anfänger, aber doch nicht ganz ohne Talent. Lachend legte ich dem Bruder nun den Goetheband vor und da machte er große Augen.
Aus: Paul Deussen: Mein Leben